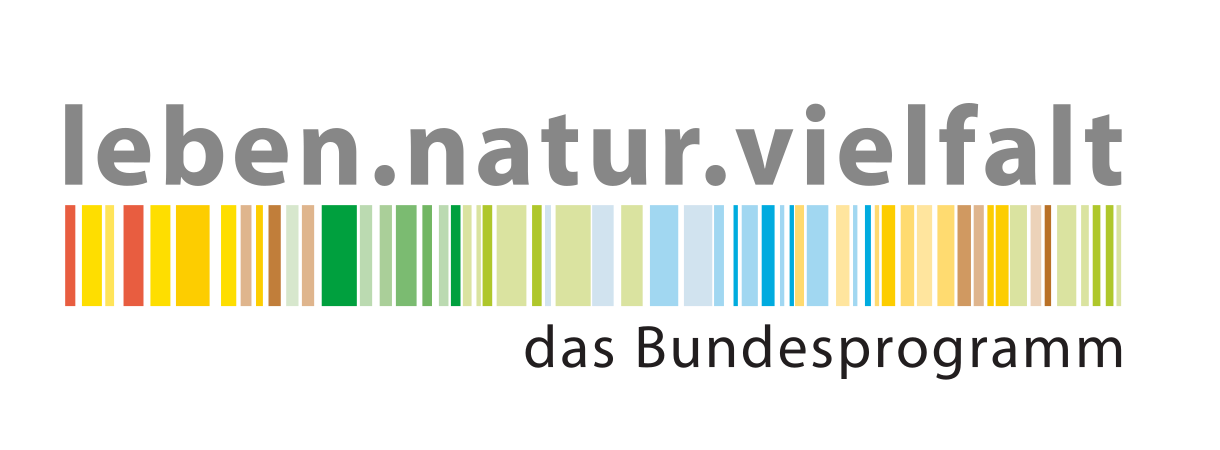- Saarländische Akademie für Artenkenntnis – Kurse und Veranstaltungen 2025
Das Kurs- und Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2025 ist jetzt online. Hier eine Übersicht.
Tiere kennenlernen: Einführung in das Beobachten, Sammeln und Bestimmen
25 Januar - 14:30 - 18:30Spezialkurs Lebermoose
31 Januar - 14:00 - 02 Februar - 16:00 at CEB-Akademie Merzig-HilbringenGrund- und Vertiefungskurs Flechten
07 Februar - 14:00 - 09 Februar - 16:00 at Zooschule im Zoo SaarbrückenGrundkurs- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Auftakt und Vorbesprechung
13 Februar - 18:00 - 20:00Grund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Einführungsseminar
21 Februar - 14:00 - 22 Februar - 18:00 at St. Ingbert, SFTZ des MINT-Campus Alte SchmelzGrund- und Vertiefungskurs Moose
07 März - 14:00 - 09 März - 15:00 at CEB-Akademie Merzig-HilbringenGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Exkursion in den Kohlen- und Atzbüsch (Saar-Mosel-Gau)
05 April - 10:00 - 18:00 at Treffpunkt Parkplatz an der B 407 bei PerlGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Exkursion in die Umgebung von Böckweiler (Saar-Blies-Gau)
26 April - 10:00 - 18:00 at Treffpunkt: Parkplatz am Südrand des Grünbachwaldes nördlich BöckweilerSpezialkurs Orchideen (Teil 1 von 2)
03 Mai - 13:00 - 19:00 at Haus Lochfeld, WittersheimGrundkurs Nachtfalter
06 Mai - 19:00 - 07 Mai - 15:00 at Haus Lochfeld, WittersheimGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Feldbotanik Wochenende Saar
09 Mai - 10:00 - 11 Mai - 15:00Einführung in die Tierbestimmung am Beispiel der Höhlenfauna
23 Mai - 13:00 - 24 Mai - 18:00 at St. Ingbert, SFTZ des MINT-Campus Alte SchmelzGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Exkursion
24 Mai - 10:00 - 18:00Tagesexkursion Vögel
31 Mai - 7:00Spezialkurs Orchideen (Teil 2 von 2)
01 Juni - 10:00 - 19:00 at Treffpunkt: Parkplatz an der B423 zwischen Bebelsheim und HabkirchenGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Exkursion
21 Juni - 10:00 - 18:00Spezialkurs Seggen und Binsen
27 Juni - 14:00 - 29 Juni - 16:00Pflanzen kennenlernen: Einführung in die Feldbotanik
04 Juli - 05 Juli at Haus Lochfeld, WittersheimGrund- und Aufbaukurs Tagfalter
11 Juli - 12 Juli at Haus Lochfeld, WittersheimGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Exkursion
19 Juli - 10:00 - 18:00Grundkurs Libellen
25 Juli - 14:00 - 26 Juli - 18:00 at St. Ingbert, SFTZ des MINT-Campus Alte SchmelzGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Feldbotanik Wochenende Saar
01 August - 10:00 - 03 August - 15:00Spezialkurs Biotopkartierung
08 August - 10 AugustGrundkurs Heuschrecken
22 August - 23 AugustGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Exkursion zur Betzenhölle südlich Neunkirchen
30 August - 10:00 - 18:00 at Treffpunkt: Mitfahrerparkplatz Neunkirchen WestspangeGrundkurs Mollusken
05 September - 10:00 - 07 September - 16:00 at Haus Lochfeld, WittersheimGrundkurs Fledermäuse
12 September - 15:00 - 13 September - 14:00 at Zooschule im Zoo SaarbrückenGrundkurs Hornmilben
26 September - 14:00 - 27 September - 18:00 at St. Ingbert, SFTZ des MINT-Campus Alte SchmelzGrundkurs Pilze
10 Oktober - 14:00 - 11 Oktober - 18:00 at Naturpark-Informationszentrum WeiskirchenGrund- und Vertiefungskurs+ Feldbotanik: Abschlussseminar
13 November - 14:00 - 15 November - 18:00
- Saarländische Akademie für Artenkenntnis – nächste Kurse und Veranstaltungen
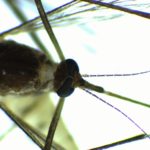
Tiere kennenlernen: Einführung in das Beobachten, Sammeln und Bestimmen
25 Januar - 14:30 - 18:30Der Start in die Artenkenntnis kann sehr vielseitig sein. Dieses Onlineangebot soll ein erstes Fundament aufbauen und zum Weitermachen anregen. In unserem Einführungs- und Grundlagenkurs lernen Sie sowohl, wie man ... Weiterlesen

Spezialkurs Lebermoose
31 Januar - 14:00 - 02 Februar - 16:00Lebermoose haben die Ausstrahlung des Besonderen. Kaum eine Pflanzengruppe kann den genauen Betrachter mit dem Zauber ihrer vielfältig gestaltetetn und reizvollen Ästhetik so in den Bann ziehen. Lebermoose bevorzugen feuchte ... Weiterlesen

Grund- und Vertiefungskurs Flechten
07 Februar - 14:00 - 09 Februar - 16:00Alle reden vom Klimawandel. Aber wer kennt schon die VDI-Richtlinie 3957 Blatt 20 zum Nachweis lokaler Klimaveränderungen mit Flechten. Die Beschäftigung mit Flechten ist jedoch anfangs ein komplexer, schwieriger und ... Weiterlesen
- Kurzfilm: Sehen.Erkennen.Bewahren.
Artenkenntnis im Fokus! Wir haben einige unserer Kurse filmisch begleitet und die Dozent:innen der SAKA, die ihr Artenwissen hier weitergeben, zu Wort kommen lassen. Hier der erste von vier Trailern zum Kurzfilm Sehen.Erkennen.Bewahren.
Zum Hintergrund:
Zusammen mit vielen Tier-, Pflanzen und Pilzarten, ist auch das Wissen über diese Organismen in Gefahr. Ohne Artenkenntnis können wir unsere Natur auch nicht schützen, das folgt aus einer einfachen Schlussfolgerung. Denn man schützt nur was man kennt und man kennt nur, was einem beigebracht wurde. Die SAKA (Saarländische Akademie für Artenkenntnis) möchte Artenkenntnis wieder in unsere Gesellschaft integrieren. - SAKA-Flechten-Exkursion 25.2.2023 – Porphyrit-Steinbruch bei Herschweiler-Pettersheim
Im Rahmen der Flechtenkurse an der Saarländische Akademie für Artenkenntnis (SAKA) fand am Samstag, 25.2.2023 unter Leitung von Dr. Volker John eine flechtenkundliche Exkursion statt. Solche Exkursionen sind Teil des Mentoring. Ziel war der ehemalige Steinbruch bei Herschweiler-Pettersheim im Messtischblatt (TK25) 6510 Glan-Münchweiler.
Das Exkursionziel wurde gewählt, nachdem Erwin Breit dort weitläufige Flächen von Cladonia rangiformis beobachtet hat, zusammen mit der bisher wenig beachteten Cladonia cariosa sowie der neuerdings in Ausbreitung begriffenen epiphytischen Melanohalea exasperata.
Da die Exkursion vorwiegend der Lehre und Vertiefung der Biologie und Ökologie der Flechten diente, gibt die folgende Artenliste nicht das vollständige Inventar an Flechten im Steinbruch wieder. Dennoch geben die gelisteten 87 Arten einen guten ersten Überblick. Darunter befinden sich auch einige seltenere Arten wie Porpidia ochrolemma und Rhizocarpon petraeum, Rote-Liste-Arten wie Cladonia cariosa und Haematomma ochroleucum sowie 8 geschützte Arten.
Teilnehmer: Erwin Breit, Jens Fricke, Peter Hinske, Achim Kiebel, Julia Klauck, Hans-Peter Schwarz.
Leitung: Volker John
Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet
Fundort
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Saar-Nahe-Bergland, Nordpfälzer Bergland, TK25: 6510/122, ehemaliger Steinbruch am Hühnerkopf östlich Herschweiler-Pettersheim. 400 m. 25.2.2023.
Abkürzungen:
- EUZ — Eutrophierungszeiger nach VDI (2005)
- KWZ — Klimawandelzeiger nach VDI (2017)
- § — Geschützt nach BArtSchV
- Cb — Carpinus betulus
- Cs — Cornus sanguinea
- E — Erde
- Ma — Mauerwerk
- Mo — Morsches Holz
- Qu — Quercus sp.
- P — Porphyrit
- Sa — Salix sp.
- RLDE — Einstufung in der Roten Liste Flechten Deutschland nach Wirth et al. (2011)
Wenn zur Roten Liste keine Angaben gemacht werden, gelten die Arten als ungefährdet.
Die Nomenklatur richtet sich nach Printzen et al. (2022). Die deutschen Namen können in Cezanne et al. (2016) nachgelesen werden.
Flechten (lichenisierte Pilze)
- Acarospora nitrophila H.Magn. — P
- Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. — P
- Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. — Sa
- Arthonia radiata (Pers.) Ach. —Cb, RLDE: V,
- Bacidina neosquamulosa (Aptroot & Herk) S.Ekman —Cb
- Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. —P
- Buellia griseovirens (Sm.) Almb. —Sa
- Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. —P
- Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll.Arg. —P
- Candelariella xanthostigmoides agg./steril —Sa
- Catillaria chalybeia (Borrer) A.Massal. —P
- Catillaria lenticularis (Ach.) Th.Fr. —P
- Catillaria nigroclavata (Nyl.) J.Steiner —Sa, RLDE: V,
- Cladonia rangiformis Hoffm. —E
- Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. —Qu, RLDE: 2,
- Cladonia fimbriata (L.) Fr. —E
- Cladonia furcata (Huds.) Schrad. —E
- Cladonia rangiformis Hoffm. —E
- Cladonia subulata (L.) F.H.Wigg. —E
- Clauzadea monticola (Ach.) Hafellner & Bellem. — Ma
- Diplotomma chlorophaeum (Leight.) Kr.P.Singh & S.R.Singh — P
- Evernia prunastri (L.) Ach. —Sa
- Flavoplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting— Ma, EUZ
- Flavoplaca flavocitrina (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting— Ma
- Flavoparmelia caperata (L.) Hale — Sa, §, KWZ
- Graphis scripta (L.) Ach. —Cb, RLDE: V
- Haematomma ochroleucum (Neck.) J.R.Laundon —P, RLDE: 3,
- Hypogymnia physodes (L.) Nyl. —Sa
- Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. —Sa
- Jamesiella anastomosans (P.James & Vězda)Lücking, Sérus. & Vězda —Cb
- Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom —Sa
- Lecanora chlarotera Nyl. —Sa
- Lecanora expallens Ach. —Cb, Sa
- Lecanora horiza (Ach.) Linds. —P, RLDE: 3,
- Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. —P
- Lecanora semipallida H. Magn. —Ma, P
- Lecidea fuscoatra (L.) Ach. —P
- Lecidea grisella Flörke —P
- Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy —Cb, Sa
- Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert —P
- Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert —P
- Lepraria finkii (B. de Lesd.) R.C.Harris — Qu
- Lepraria incana (L.) Ach. — Qu, P
- Lepraria vouauxii (Hue) R.C.Harris — Ma
- Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup —Qu, Sa, §
- Melanelixia subaurifera (Nyl.) O.Blanco et al. —Cb, Sa, §
- Melanohalea exasperata (De Not.) O.Blanco et al. — Cs, §, RLDE: 2,
- Parmelia saxatilis (L.) Ach. —Qu, §
- Parmelia sulcata Taylor —Qu, Sa, §
- Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy — Sa, §, RLDE: V, KWZ
- Peltigera rufescens (Weiss) Humb. — E
- Phlyctis argena (Spreng.) Flot. — Cb, Qu, Sa
- Physcia adscendens H.Olivier —Sa, EUZ
- Physcia aipolia (Humb.) Fürnr. — Sa
- Physcia caesia (Hoffm.) Fürn. — P
- Physcia stellaris (L.) Nyl. —Sa
- Physcia tenella (Scop.) DC. —Sa, EUZ
- Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P.James — Mo
- Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb. —Sa
- Polycauliona polycarpa (Hoffm.) Frödén, Arup & Søchting—Cb, Sa, EUZ
- Polyozosia albescens (Hoffm.) S.Y.Kondr., Lökös & Farkas —Ma
- Polyozosia dispersa (Pers.) S.Y.Kondr., Lökös & Farkas — P, EUZ
- Polyozosia semipallida (H.Magn.) S.Y.Kondr., Lökös & Farkas —Ma, P
- Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph —P
- Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph —P
- Porpidia ochrolemma (Vain.) Brodo & R.Sant. —P, RLDE: R,
- Porpidia soredizodes (Nyl.) J.R.Laundon —P
- Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph —P
- Protoblastenia rupestris (Scop.) J.Steiner — Ma
- Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M.Choisy — P, EUZ
- Psilolechia lucida (Ach.) M.Choisy — P
- Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog —Sa, §, KWZ
- Ramalina farinacea (L.) Ach. — Sa, §
- Rhizocarpon distinctum Th.Fr. — P
- Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A.Massal.. — P, RLDE: 2,
- Rinodina aspersa (Borrer) J.R.Laundon — P, EUZ
- Rusavskia elegans (Link) S.Y.Kondr. & Kärnefelt —P
- Sarcogyne regularis Körb. — Ma
- Trapelia coarctata (Sm.) M.Choisy — P
- Trapelia glebulosa (Sm.) J.R.Laundon — P
- Trapelia placodioides Coppins & P.James — P
- Verrucaria dolosa Hepp — Ma
- Verrucaria muralis Ach. — Ma
- Verrucaria nigrescens Pers. —Ma
- Violella fucata (Stirt.) T.Sprib. —Cb
- Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. — Qu, Sa, EUZ
Flechtenparasiten (lichenicole Pilze)
- Zyzygomyces physceacearum (Diederich) Diederich, Millanes & Wedin auf Physcia tenella

Abb. 2: Melanohalea exasperata in feuchtem Zustand (Foto: Erwin Breit) 
Abb. 3: Aktuell bekannte Verbreitung von Melanohalea exasperata (Karte: Volker John) 
Abb. 4: Habitus von Porpidia ochrolemma (Foto: Volker John) 
Abb. 5: Aktuell bekannte Verbreitung vonPorpidia ochrolemma (Karte: Volker John) Literatur
BArtSchV (2012): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005, zuletzt geändert 3. Oktober 2012, Bundesartenschutzverordnung. – Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 11. Bonn.
Cezanne, R., Eichler, M., Berger, F., Brackel, v. W., Dolnik, C., John, V. & Schultz, M. (2016): Deutsche Namen für Flechten. – Herzogia 29: 745-797.
Printzen, C., Brackel, W. v., Bültmann, H., Cezanne, R., Dolnik, C., Dornes, P., Eckstein, J., Eichler, M., John, V., Killmann, D., Nimis, P. L., Otte, V., Schiefelbein, U., Schultz, M., Stordeur, R., Teuber, D., Thüs, H. (2022): Die Flechten, flechtenbewohnenden und flechtenähnlichen Pilze Deutschlands. Eine überarbeitete Checkliste. – Herzogia 35: 193-393.
Verein Deutscher Ingenieure (2023): Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Bioindikation). Kartierung der Diversität epiphytischer Flechten als Indikator für Luftgüte. – VDI-Richtlinie 3957 Blatt 13. VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft 1a: 1-30. Beuth Verlag.
Verein Deutscher Ingenieure (2017): Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Biomonitoring). Kartierung von Flechten zur Ermittlung der Wirkung von lokalen Klimaveränderungen. – VDI-Richtlinie 3957 Blatt 20, VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 1a: 1-35. Beuth Verlag.
Wirth, V., Hauck, M., Brackel, W.v., Cezanne, R., de Bruyn, U., Dürhammer, O., Eichler, M., Gnüchtel, A., John, V., Litterski, B., Otte, V., Schiefelbein, U., Scholz, P., Schultz, M., Stordeur, R., Feuerer, T. & Heinrich, D. (2011): Rote Liste und Artenverzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(6): 7-122.
Autor:
Dr. Volker John
Bietschieder Institut für Natur und Kultur
Kaiserslauterer Str. 86
67098 Bad Dürkheim
Deutschland - Makro-Fotografierkurs sehr erfolgreich
Am 18. und 19. Juni 2022 fand in den Räumen der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis in Landsweiler-Reden im Rahmen ein Kurs zur Mikro- und Makrofotographie statt – als Gemeinschaftsveranstaltung der Bryologisch–lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa e.V. (BLAM) der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis (SAKA) und der Naturforschenden Gesellschaft des Saarlandes (DELATTINIA).
Als Referent konnte Herr Dr. Norbert Stapper (BLAM) gewonnen werden. Als Moderator der Schulung konnte Herr Dr. Volker John zusätzliche Informationen beisteuern. Neben drei Mitgliedern der DELATTINIA konnten 5 Gäste der BLAM in Landsweiler Reden zum Kurs begrüßt werden. Die Teilnehmer waren im Vorfeld gebeten worden ihre persönliche Fotoausrüstung mitzubringen. So konnten zahlreiche Ausrüstungsgegenstände, Stative, Objektive und digitale Fotoapparate besprochen werden. Auch ein Stereomikroskop war mit am Start.
Herr Dr. Stapper erläuterte uns in den ersten Stunden die physikalischen und fotografischen Grundlagen und ging dabei ausführlich auf die notwendige Software ein. Besonderen Augenmerk legte er dabei auf die Rolle des Lichtes, der Beleuchtungstechnik und auf die Bedeutung des Weißabgleichs. Das Thema Stapelaufnahme (Stacking) füllte dann den praktischen Teil. Jeder der Teilnehme hatte dann die Gelegenheit eigene Aufnahmen mit diesem Verfahren anzufertigen.
Es entwickelten sich viele spannende Diskussionen, die von Herrn Dr. Stapper in höchst kompetenter Weise begleitet wurden.
Die rege Teilnahme und die Begeisterung der Teilnehmenden stärkt uns darin, dieses Format als Zusatz zu den Artenkenntniskursen in der Schulungsreihe der SAKA weiter zu führen.
- Mooskurs 2022
Der diesjährige Mooskurs der SAKA – Saarländischen Akademie für Artenkenntnis hat am Wochenende vom 12.-13.03.2022 stattgefunden. Mit viel Akribie und Motivation konnten die Teilnehmer:innen sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis – bei herrlichem Mooswetter – auf den Exkursionen einen Einblick in die doch sehr diffizile Artengruppe gewinnen. Einige von ihnen haben den Kurs bereits das zweite Mal absolviert, um ihr Wissen weiter zu festigen.
- Ministerieller Besuch bei FörTax

Minister Reinhold Jost beim Betrachten einer Hummel Am Donnerstag, 03.03.2022, besuchte Umweltminister Reinhold Jost gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Thul und der Leiterin der Abteilung Naturschutz und Forsten, Helga May-Didion, die Saarländische Akademie für Artenkenntnis (SAKA). Sie begleiteten einen Workshop, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Bestimmung von Tieren und Pflanzen anhand von Wildbienen, Moosen und Flechten exemplarisch erarbeiten.

Staatssekretät Sebastian Thul im Workshop der SAKA Als sie eintreffen, ist Dr. Julia Michely gerade dabei, den Teilnehmenden die Unterschiede zwischen zwei Hummelarten zu erläutern. Jost erkundigt sich über den bisherigen Fortschritt des Aufbaus der Akademie. „Die Kurse wurden bisher sehr gut angenommen und die Ergebnisse sind vielversprechend“, so Jost. „Wir wollen mit dem Projekt noch mehr Menschen für Artenkenntnis und Naturschutz begeistern. Dabei gilt der Leitsatz: Man kann nur schützen, was man kennt und schätzt.“
Thul erkundigt sich über die innerhalb des Vorhabens begonnene App zur Dokumentation von Artbeobachtungen auf dem „Floristisch-Faunistischen Informationsportal (FFIpS)“ und stellt fest „auch ich nutze eine App auf meinem Handy – Flora Incognita, die kennen hier sicher viele – die mich bei der Bestimmung von Pflanzen sehr gut unterstützt“. Neben den Kursen und der Lehrsammlung soll die App, die im Mai veröffentlicht wird, ein weiteres Standbein bei der Entwicklung zum Artenkenner sein, wie Herr Schneider, Dozent und Leiter der Akademie-Teams, erläutert. „Wir wollen mit diesem Angebot insbesondere die junge Generation ansprechen, die mit der digitalen mobilen Welt des Handys aufwächst“. Die FFIpS-App diene weniger der Bestimmung, sondern der Überprüfung der beobachteten Arten durch die Mentoren und Artspezialisten. „Wir wollen mit unterschiedlichen Formaten einer möglichst breiten Zielgruppe Lern- und Betätigungsmöglichkeiten bieten, aber auch nicht das Rad neu erfinden“.
Beim Verlassen gegen Mittag wird noch die neu angeschaffte Informationsstele bewundert, auf dem gerade eine Foto-Dokumentation der Präsenzkurse des vergangenen Jahres zu sehen ist.
- SAKA Team komplett
Seit 01. Mai ist unser Team jetzt komplett. Montags nach dem Maifeiertag verbrachte Nicole Haag unsere präparationstechnische Assistentin ihren ersten Arbeitstag im alten Zechengebäude in Landsweiler-Reden. Wir freuen uns, dass wir nun vollständig sind und richtig loslegen können.
- Tiere kennenlernen!
Grund- und Einführungskurs wird wiederholt
Wegen des guten Feedbacks und weiterer Nachfrage, werden wir den Kurs wiederholen. Die Anmeldung erfolgt über unsere Veranstaltungsseite.

Für weitere Infos, folgt uns auf Twitter…
- Es geht los!
Am 16. April wird unser erster virtueller Kurs stattfinden. Tiere kennenlernen: Einführung in das Beobachten, Sammeln und Bestimmen, das sind die wesentlichen Inhalte des Kurses, der sich an Interessierte richtet, die gerne von vorne beginnen würden. Das Besondere daran: Trotz virtueller Veranstaltung wird auch praktisch gearbeitet! Zur Anmeldung hier klicken.
- Start der Präsenzveranstaltungen Mitte des Jahres?
Wir sind mitten in der Planung der Kurse und die ersten Termine stehen fest. Ab Juli hoffen wir mit unseren Präsenzveranstaltungen starten zu können. Vorgesehen sind Kurse zu Nachtfaltern, Fledermäusen, Schnecken, Moosen, Flechten, wirbellosen Wassertieren und Höhlenfauna. Also Masken auf und durchhalten 😉